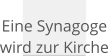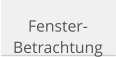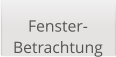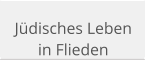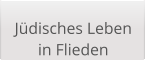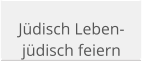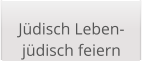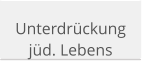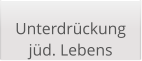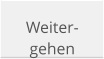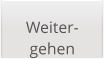Glossar L - M
Landjudentum
Das Landjudentum - ein Begriff, der sich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts etablierte. Im Mittelalter
lebten die Mehrzahl der Juden in den Städten, bis sie zur Zeit der hochmittelalterlichen Pest Pogrome und
antijudaistischen Verfolgungen (z.B. ShUm Städte / Mainz, Speyer, Worms) gezwungenermaßen nach
Osteuropa fliehen mussten oder in die Dörfer zogen.
Die so genannten "Landjuden" lebten meist verstreut und vereinzelt am Rand der Dörfer. Von den
Gemeinderechten waren sie weit gehend ausgeschlossen. Zu den christlichen Nachbarn bestanden selten
Freundschaften. Heiratsbeziehungen waren unmöglich, Ehen wurden nur unter Juden nach den israelitischen
Gesetzen geschlossen. Ihre Wirtschaftslage war meist sehr prekär.
Erst im Laufe von Generationen gelang es den vereinzelten jüdischen Familien, sich wieder als
Glaubensgemeinden zu etablieren. Der Mittelpunkt des religiösen Lebens war die Dorfsynagoge. Sie war das
Zentrum des Gemeindelebens. Mitte / Ende des 19. Jahrhunderts fand eine starke Abwanderung des
Landjudentums statt. Vor allem die jüngere Generation zog es in die größeren Städte oder ins Ausland, um
dort ein besseres Leben zu führen.
Für die endgültige Auslöschung der Landjuden sorgte der Terror der Nationalsozialisten. Sie zerstörten die
meisten Dorfsynagogen und Friedhöfe, schikanierten und misshandelten die Juden bis zur Deportation in die
Konzentrationslager. Nur wenigen gelang die Flucht ins Ausland. Nach dem 2. Weltkrieg gab es für sie keinen
Grund zur Rückkehr: Ihr Besitz war "arisiert"; die Reste der Dorfsynagogen dienten als Scheunen oder
Lagerräume, die jüdischen Friedhöfe waren meist verrottet. Das jüdische Leben geriet in Vergessenheit.
Erst in der jüngsten Vergangenheit ergriffen engagierte Bürger und Gemeinden Initiativen, um die ins
Ausland emigrierten jüdischen Dorfbewohner wenigstens zu einem Besuch ihrer alten Heimat einzuladen.
Parallel begann man damit, die baulichen Zeugnisse jüdischen Lebens auf dem Lande zu restaurieren, um
damit die Erinnerungen an das Landjudentum in Deutschland wieder wachzurufen.
Mazzen / Mazzot
Für das Pessachfest vorgeschriebenes, ungesäuertes Brot, nur „echt“ wenn vom Rabbinat gekennzeichnet.
Menora
Heißt der siebenarmige Leuchter.
Mesusa
Das hebräische Wort für "Türpfosten". Gemeint ist ein kleiner Behälter, der die Tora-Abschnitte auf einer
kleinen Pergamentrolle enthält und aus rituellen Zwecken am rechten Türpfosten , nach links geneigt, eines
jüdischen Wohneingangs befestigt wird.
Mikwe
Ein Tauchbad, das jede jüdische Gemeinde besitzt. Vor der Eheschließung nimmt die Braut ein rituelles Bad.
Nach der Entbindung oder der Menstruation muss die Frau ein Bad in der Mikwe einnehmen. Das Wasser
muss fließend „lebendig“ sein. (Grundwasser oder Regenwasser).
Dieser Vorgang kann auch in Flüssen oder im Meer praktiziert werden. In früheren Zeiten war das Wasser der
Mikwe natürlich kalt, heute sind die Mikwen sehr komfortabel eingerichtet und beheizt.
Mizwa (Plural: Mizwot)
Jüdisch-religiöse Gebote.eginnt danach die Trauerwoche, das Schiwa sitzen. Heutzutage sprechen Männer wie
Frauen das Kaddisch.
„Bruchlinien“-

Weitergehen

Das Landjudentum - ein Begriff, der sich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts etablierte. Im Mittelalter
lebten die Mehrzahl der Juden in den Städten, bis sie zur Zeit der hochmittelalterlichen Pest Pogrome und
antijudaistischen Verfolgungen (z.B. ShUm Städte / Mainz, Speyer, Worms) gezwungenermaßen nach
Osteuropa fliehen mussten oder in die Dörfer zogen.
Die so genannten "Landjuden" lebten meist verstreut und vereinzelt am Rand der Dörfer. Von den
Gemeinderechten waren sie weit gehend ausgeschlossen. Zu den christlichen Nachbarn bestanden selten
Freundschaften. Heiratsbeziehungen waren unmöglich, Ehen wurden nur unter Juden nach den israelitischen
Gesetzen geschlossen. Ihre Wirtschaftslage war meist sehr prekär.
Erst im Laufe von Generationen gelang es den vereinzelten jüdischen Familien, sich wieder als
Glaubensgemeinden zu etablieren. Der Mittelpunkt des religiösen Lebens war die Dorfsynagoge. Sie war das
Zentrum des Gemeindelebens. Mitte / Ende des 19. Jahrhunderts fand eine starke Abwanderung des
Landjudentums statt. Vor allem die jüngere Generation zog es in die größeren Städte oder ins Ausland, um
dort ein besseres Leben zu führen.
Für die endgültige Auslöschung der Landjuden sorgte der Terror der Nationalsozialisten. Sie zerstörten die
meisten Dorfsynagogen und Friedhöfe, schikanierten und misshandelten die Juden bis zur Deportation in die
Konzentrationslager. Nur wenigen gelang die Flucht ins Ausland. Nach dem 2. Weltkrieg gab es für sie keinen
Grund zur Rückkehr: Ihr Besitz war "arisiert"; die Reste der Dorfsynagogen dienten als Scheunen oder
Lagerräume, die jüdischen Friedhöfe waren meist verrottet. Das jüdische Leben geriet in Vergessenheit.
Erst in der jüngsten Vergangenheit ergriffen engagierte Bürger und Gemeinden Initiativen, um die ins
Ausland emigrierten jüdischen Dorfbewohner wenigstens zu einem Besuch ihrer alten Heimat einzuladen.
Parallel begann man damit, die baulichen Zeugnisse jüdischen Lebens auf dem Lande zu restaurieren, um
damit die Erinnerungen an das Landjudentum in Deutschland wieder wachzurufen.
Für das Pessachfest vorgeschriebenes, ungesäuertes Brot, nur „echt“ wenn vom Rabbinat gekennzeichnet.
Heißt der siebenarmige Leuchter.
Das hebräische Wort für "Türpfosten". Gemeint ist ein kleiner Behälter, der die Tora-Abschnitte auf einer
kleinen Pergamentrolle enthält und aus rituellen Zwecken am rechten Türpfosten , nach links geneigt, eines
jüdischen Wohneingangs befestigt wird.
Ein Tauchbad, das jede jüdische Gemeinde besitzt. Vor der Eheschließung nimmt die Braut ein rituelles Bad.
Nach der Entbindung oder der Menstruation muss die Frau ein Bad in der Mikwe einnehmen. Das Wasser
muss fließend „lebendig“ sein. (Grundwasser oder Regenwasser).
Dieser Vorgang kann auch in Flüssen oder im Meer praktiziert werden. In früheren Zeiten war das Wasser der
Mikwe natürlich kalt, heute sind die Mikwen sehr komfortabel eingerichtet und beheizt.
Jüdisch-religiöse Gebote.eginnt danach die Trauerwoche, das Schiwa sitzen. Heutzutage sprechen Männer wie
„Bruchlinien“-

Weitergehen